design security forum AG – Wir nehmen Brandschutz persönlich!
Das design security forum bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsveranstaltungen und Seminaren rund um die bauliche Sicherheitstechnik an.
Unsere hochkarätigen Referenten aus Planung, Forschung und Industrie halten Sie als ArchitektIn, FachplanerIn, FacilitymanagerIn oder auch BehördenvertreterIn stets auf dem neusten Stand des Brandschutzes auf nationaler und internationaler Ebene.
Profitieren Sie von unserem geballten Fachwissen. Wir freuen uns auf Sie!
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise
Demnächst:
29.04.2024 | Online | Brandfallsteuermatrix: Zusammenwirken von Anlagen und Wirk-Prinzip-Prüfung
Datum: 29.04.2024
Ort: Online
Zeit: 09:00-17:00 Uhr
Referent: Dipl.-Ing. Karl-Olaf Kaiser
Kosten: 329,– € zzgl. USt
Seminarnr.: 4-02-BS2024
13.-17.05.2024 | Online | Ausbildung zum Fachbauleiter
Datum: 15.04.-03.05.2024
Ort: Online
Zeit: 09:00-17:00 Uhr
Referent: Ing. Wolfgang Scharf
Kosten: 2599,–€–+249,– € Prüfungsgebühr zzgl. USt
Seminarnr.: 05-1-FBL2024
Unsere Referenten
Rechtsanwalt bei Winter & Kollegen Maintal, Lehrbeauftragter für öfftl. & priv. Baurecht Technische Universität Kaiserslautern, Vorstand der design security forum AG, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) e. V.

GÖTZ WINTERRECHTSANWALT
Brandschutzconsultant und –planer (Frankfurt a.M.), Autor u.a. „Brandschutztechnische Bauüberwachung Haustechnik“, Länderdossier „Brandschutz in China“ (deutsch & engl.), Mitautor Gädtke Kommentar BauO NRW 2019, Referent für Brandschutz u.a. EIPOS, VDI, UTech und Caribbean School of Architecture, Jamaica

KARL-OLAF KAISERDIPL.-ING.
Co-Gründer und Geschäftsführer der DFATT. Er war 30 Jahre lang Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Metallbaubetriebs. Seit 2005 ist er öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Metallbauerhandwerk. Seit 2014 ist er zudem als Dozent, Fachreferent und Fachautor im Bereich Türtechnik tätig

JOSEF FAßBENDER
ö.b.u.v. Sachverständiger der IHK Mittlerer Niederrhein für den baulichen und anlagentechnischen Brandschutz und der HWK Düsseldorf für das Installateur- und Heizungsbauerhandwerk, sowie Sachverständiger des vorbeugenden Brandschutzes (EIPOS/IHK Dresden), Herausgeber und Mitautor der Kommentare zur MLAR und M-LüAR. Geschäftsführender Gesellschafter bei der ML Sachverständigen Gesellschaft mbH und Gesellschafter der LiComTec GmbH, Krefeld. Dozent bei Eipos, Dresden für den gebäudetechnischen Brandschutz und Referent beim VDI Bildungswerk

MANFRED LIPPEDIPL.-ING.
Inhaber der Planungsgruppe Geburtig, Prüfingenieur für vorbeugenden Brandschutz, VPI, Honorarprofessor für das Fachgebiet “Brandschutz” an der Bauhaus-Universität Weimar, Fachbuchautor, Dozent EIPOS Dresden

GERD GEBURTIGPROF. DR.-ING. HABIL.
Sicherheits- & Brandschutzingenieur, Fachkraft für den Arbeitsschutz, Brandschutzmanager, Fachplaner für den vorbeugenden baulichen und organisatorischen Brandschutz, Störfall-& Gefahrstoffbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter, Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, Datenschutzbeauftragter, Dozent in der Erwachsenenbildung

WOLFGANG SCHARFING.
Geschäftsführer und Gesellschafter der GBS-Consulting GmbH, Bauaufsichtlich anerkannter Prüfsachverständiger für Druckbelüftungsanlagen, Mitglied im RDA-Arbeitskreis

CHRISTOPH SOMMERDipl.-Ing.
Brandoberamtsrat a.D., anerkannter Sachverständiger Feuerwehr für vorbeugenden Brandschutz – HLFS, 1974–2015 Brandoberamtsrat vorbeugenden Brandschutz der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main, 2007–2015 Landesfeuerwehrverband Hessen, Vorsitzender Fachausschuss vorbeugenden Brandschutz,2007–2015 AkH-Mitglied Prüfungsausschuss für Prüfsachverständige Brandschutz, 2017 Nachweisberechtigter Vorbeugender Brandschutz-AKH, seit 2015 freiberuflich tätig.

KLAUS TÖNNES
Seminar-News
Kontakt
design security forum AG
Weiherstraße 3
63477 Maintal
Sprechzeiten:
Mo. – Do. von 09.00 bis 14.00 Uhr
Telefon +49 6181 906 850-80 organisation@design-security-forum.de
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise. Den Nettopreisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe hinzu zu setzen.

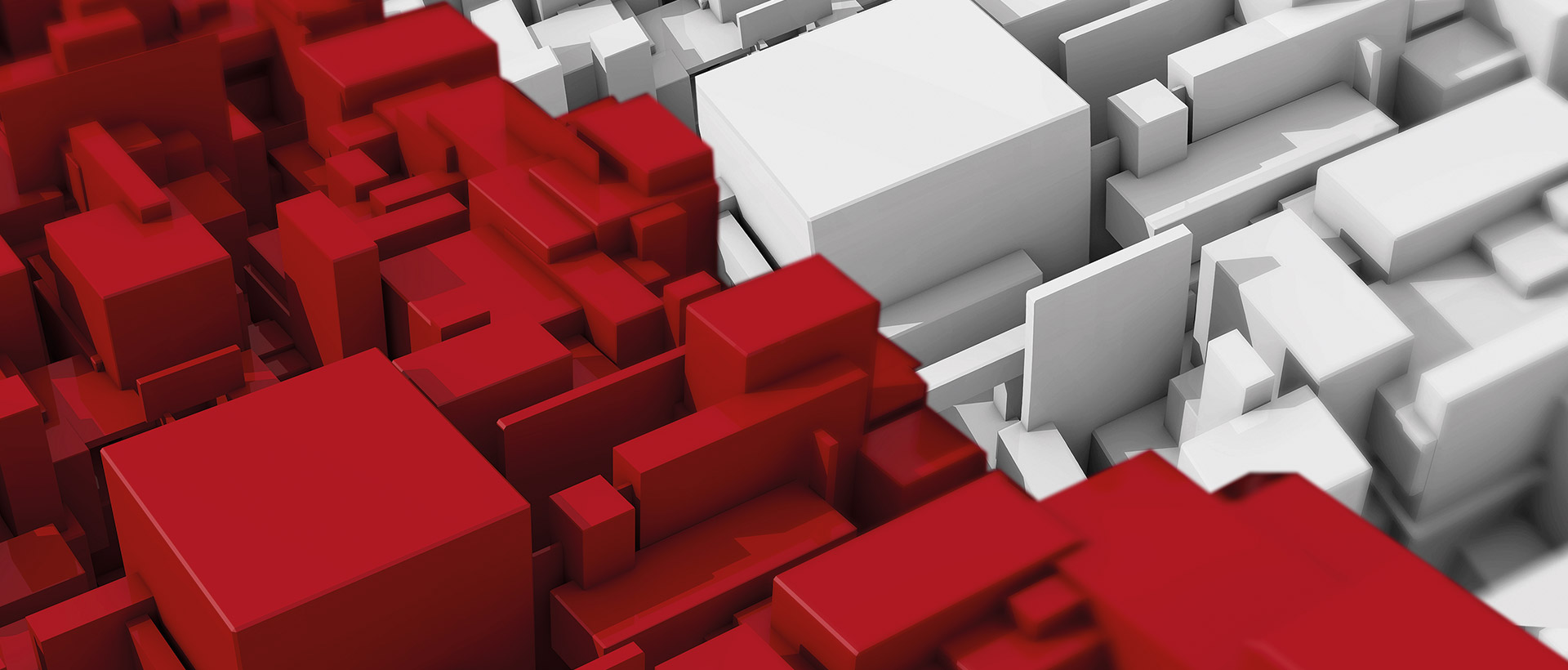


 © Adobe Stock / industrieblick
© Adobe Stock / industrieblick